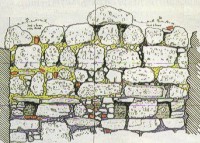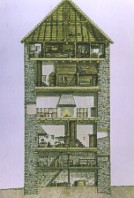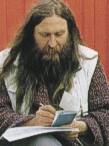|
Abenberg:
Wie Phönix aus der Asche

In
burgenkundlicher Hinsicht sehr bedeutend waren die Erkenntnisse, die sich
aus der Burgenforschung an dieser Burg im Landkreis Roth ergaben. Diese
bestanden aus der Auswertung von 1988-1992 im Burghof durchgeführten
regulären Grabungen, nicht überarbeiteten fotogrammetrischen Aufnahmen
und aus ergänzender Bauforschung an den noch unverputzten Bauteilen.
Letztlich
gelang es trotz der nicht unerheblichen Substanz- und Informationsverluste
durch die schon erfolgte Restaurierung und Sanierung, die Baugeschichte
der Burganlage soweit aufzuschlüsseln, dass vier wesentlich Bauphasen
bildhaft rekonstruiert werden konnten.
Von
diesen vier Bauphasen war die erste nur
archäologisch über Fundamente und
Ausbruchgruben erfassbar: eine um 1130/40 erbaute imposante
Turmburg der mächtigen Abenberger Grafen (ca.1050-1200), die für
museale Zwecke sowohl zweidimensional als auch dreidimensional
rekonstruiert wurden.
Zeittypisch war das sorgfältig geschichtete kleinformatige
Quadermauerwerk. Diese Turmburg, die zu den größten Bayern gehörte,
blieb Bestandteil einer neuen, zwischen 1230 und 1250 von den Hohenzollern
errichteten Ringmauerburg, die charakterisiert wird von Buckelquadern.
Entlang der Ringmauer erhoben sich neben dem Palas mehrere Burgmannenhäuser.
Steinmetzzeichen auf den Buckelquadern bewiesen, dass die Steinmetze von
hier auf die Hohenzollernburgen Wernfels und Cadolzburg weiterzogen und
dort tätig wurden. 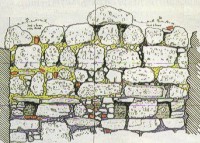
Darüber
hinaus muss aufgrund auffälliger konzeptioneller Ähnlichkeiten ein- und
derselbe Baumeister den Neubau der Burgen Abenberg und Cadolzburg geplant
und realisiert haben. 1296 erwarb das Hochstift Eichstätt die
Burganlage und richtete hier ein Pflegamt ein. Nun erfolgte vor allem ein
Ausbau der Räumlichkeiten. In den 1880er Jahren erfuhr die
vernachlässigte Burgruine glücklicherweise eine burgenromantis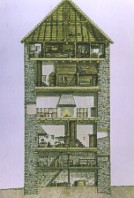 che,
neugotische Erneuerung, indem Baulichkeiten instandgesetzt und
"ritterlich" eingerichtet, Türme und Erkertürmchen hinzugefügt
und alles mit che,
neugotische Erneuerung, indem Baulichkeiten instandgesetzt und
"ritterlich" eingerichtet, Türme und Erkertürmchen hinzugefügt
und alles mit
Miniaturzinnen garniert wurde.
Damit
entpuppte sich die Burg Abenberg als ein für vier Bauepochen hochrangiges
Objekt, an dem das Wachsen und Werden einer Burg in wichtigen
zeittypischen Bauformen bis hin zur burgenkundlicher Rezeption im
Historismus greifbar wird. Seriöse,
dreidimensionale Inszenierungen in den beiden Ausstellungsräumen befreien
diese neuen Informationen vom wissenschaftlichen Moder und erfüllten sie
mit Leben. Dadurch werden modernste Aspekte der Burgenkunde,
Burgenforschung, Baugeschichte und des Burglebens spannend und anschaulich
vermittelt.
Interview:
(Auszug)
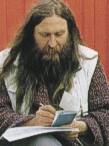
Der selbständige Mittelalterarchäologe Dr.
Joachim Zeune hat etwas geschafft, wovon die meisten Menschen nur
träumen: Er hat seine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Seit 1995 betreibt
er in Bamberg ein „Büro für Burgenforschung“.
DAMALS
sprach mit ihm über diese in Deutschland einzigartige Einrichtung.
DAMALS: Welche
Art von Dienstleistungen bieten Sie in Ihrem „Büro für Burgenforschung“
an?
ZEUNE: Wir machen praktisch einen Komplettservice um Burgruinen und
Burgen herum. Das geht von Bauforschung, Bauanalyse, Archäologie,
Dokumentation, Schadenskartierung, Sanierungskonzepten über Archivalien
bis hin zu didaktischen und
touristischen Erschließungen und
Publikationen.
DAMALS:
Wie entstand die Idee,
ein solches Büro einzurichten?
ZEUNE: Es begann damit, dass ich als Jugendlicher schon sehr großes
Interesse an Burgen hatte. Ein Problem war, dass es wenig gute Literatur
gab. Ich habe mich dann als Autodidakt in die Burgenforschung
eingearbeitet. Einen Lehrstuhl ab es ja damals noch nicht der besteht erst
seit 1982 mit der Mittelalterarchäologie in Bamberg. Ich bin in diese
Lücke hineingestoßen, habe an der Universität mein Wissen
vervollständigt. Es bestand Bedarf, denn über Burgen wurde wenig seriöse
Forschung betrieben. Von daher hat es sich angeboten, mich nach Beendigung
der Unizeit in der Burgenforschung selbständig zu machen.
DAMALS: Finanziert sich Ihr Büro als reines Wirtschaftsunternehmen?
ZEUNE:
Ja, wir arbeiten als Unternehmen. Und ich bin praktisch derjenige, der die
anfallenden Arbeiten an die verschiedenen Mitarbeiter delegiert.
DAMALS: Wie viele Mitarbeiter beschäftigen Sie?
ZEUNE:
Wir sind ziemlich viele Mitarbeiter aus lauter verschiedenen Disziplinen.
Die moderne Burgenforschung ist eine interdisziplinäre Forschung,
dementsprechend sind Kunsthistoriker, Historiker, Bauforscher und
Archäologen beteiligt. Normal ist ein Umfang von ein oder zwei Projekten
und etwa sechs Mitarbeitern.
DAMALS: Ihre Aufträge erhalten Sie aus dem ganzen Bundesgebiet?
ZEUNE: Ja, aber auch aus dem Ausland. Wir haben Projekte in
Österreich und Italien, im Moment sind wir dabei, eines in Frankreich
aufzubauen.
DAMALS: Im 19. Jahrhundert stellte man bekanntlich einen völlig
anderen Anspruch an Restaurierungen. Was halten Sie vom Wiederaufbau
von Burgen, sowohl damals als auch heute?
ZEUNE: Man muss natürlich immer im Auge behalten, dass eine Burg, so
wie sie da steht, ein Geschichtsdokument mit einer ganz eigenen
Baugeschichte ist. Es müssen etliche Dinge eingebaut werden:
Entsorgung, Versorgung, sanitäre Anlagen und vieles mehr. Vom
Originalbestand bleibt letztlich wenig übrig.
DAMALS: Wo liegen heute die Schwierigkeiten bei der Burgsanierung?
ZEUNE:
Ein alter Streit in der Denkmalpflege besteht zwischen Restaurieren oder
Konservieren. Erst in den letzten paar Jahren hat sich das Denkmalamt
dazu entschlossen, auch einmal „nein“ zu sagen. Ich bin der Meinung,
dass Rekonstruktionen besser im Kopf ablaufen sollten. Man kann zum
Beispiel eine lnfotafel mit schönen Zeichnungen aufstellen, das ist
eine sinnvolle Sache. Man kann doch eine Ruine einfach stehen lassen und
sie für die Öffentlichkeit durch Infotafeln erschließen. Also eine
sanfte Nutzung vornehmen, entgegen dem absoluten Nutzungswahn.
DAMALS: Warum
werden Maßnahmen genehmigt, die die alte Substanz zerstören?
ZEUNE: Das hat viel mit dem sogenannten
Freizeitwert zu tun. Es gab eine Zeit,
in der Gemeinden entdeckten, dass das Mittelalter hohes Interesse in
der Bevölkerung genießt. Eine Gemeinde im Bayerischen Wald zum
Beispiel hatte eine kleine Burgruine mit einem etwa sechs Meter hohen
Turmstumpf. Man fing dort an, die Burg nicht nur komplett auszugraben,
sondern ihren Turm gleich aufzustocken und ihn in ein 24 Meter hohes Ungetüm
zu verwandeln. Bei einem anderen Projekt ging es um eine Burgsanierung.
Dort hatte sich ein „Verein zum Wiederaufbau der Burgruine“ gegründet.
Seine Mitglieder haben mit der Sanierung ihrer Burgruine begannen,
was am Anfang auch gut lief. Durch ein Burgfest bekam das Ganze aber eine
Eigendynamik. Man fing an, Toiletten einzubauen, ein Dach einzuziehen,
schließlich benötigte man abschließbare Räume, in denen man Bier
und Nahrungsmittel lagern konnte. Dann hat man für eine Kellerbar ein
Gewölbe eingebaut. Es wurden weitere Burgfeste veranstaltet, worauf
die Gesundheitsbehörde mehr sanitäre Einrichtungen forderte. Auch
die Versorgung musste ausgebaut werden. Am Schluss wurde im Bergfried ein
Turmstüberl eröffnet, dann ein Museum eingerichtet. Schließlich sollte
die Burg verschließbar werden, weshalb man die Burgmauern wiedererrichtet
und ein Tor eingesetzt hat. Inzwischen veranstaltet man dort
Musikfestivals und andere große Feste. Es findet eine intensive Nutzung
statt, von der Ruine selbst ist gar nichts mehr zu erkennen.
DAMALS: Kann einem der Denkmalschutz helfen, gegen solche „Bausünden“
vorzugehen?
ZEUNE: Die Denkmal pflege ist stellenweise einfach
personell überfordert, hat zu viele Objekte zu betreuen und zuwenig
Leute. Da immer weniger Geld vorhanden ist, werden oft einfach die
billigsten Lösungen angestrebt. Andererseits wirkt sich die schlechte
Finanzlage auch positiv aus:
Heute
achten die Träger wieder darauf, wie man mit wenig Geld möglichst viel
sichern kann. Maßnahmen, die früher in einem Jahr passiert sind,
ziehen sich heute über einen Zeitraum von drei, vier Jahren, was ein
gutes
Tempo für eine Sanierung ist. Man kann zwar weniger tun, aber das
behutsamer. Daher ist es aus unserer Sicht gar nicht mal schlecht, dass
nicht mehr in dem Maß Geld vorhanden ist, auch wenn man manchmal ins
andere Extrem abrutscht.
Eine Ruine so zu
sanieren, dass sie noch ein paar
hundert Jahre hält und man nicht das Gefühl hat, etwas zerstört zu
haben, ist Verantwortung genug. Das ist die Philosophie, die ich habe und
die meine Mitarbeiter teilen.
Das Interview führte Benedikt Leder.
|